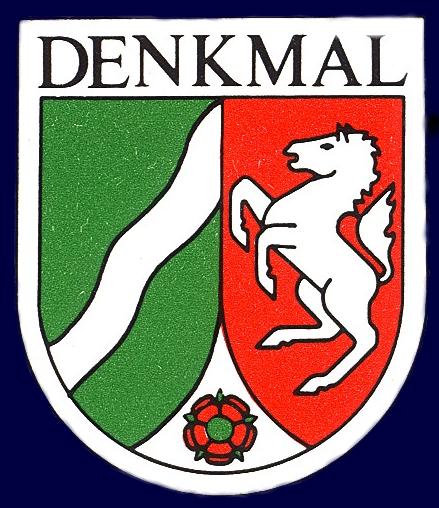|
|
||
Denkmale in der Stadt Mönchengladbach |
||
Nr. G 053 |
||
|
Standort: Gerkerather Mühle 38, D 41179 Mönchengladbach - Rheindahlen GPS: 51o 09' 24,8" N 06o 21' 46,6 O Zuständigkeit: Privat Baujahr: 1733 Tag der Eintragung als Denkmal 5. Juni 2007 Quellenhinweis: Teilbeschreibung der Denkmalbehörde
|
|
Gerkerather Mühle in Rheindahlen
Die Gerkerather Mühle liegt
am gleichnamigen Weg Gerkerather Mühle im Norden von Rheindahlen. Auf
einer Erdanschüttung errichteter, leicht konischer, aus
Feldbrandsteinen erbauter, runder und ungegliederter Mühlenturm einer
Turmwindmühle ('Erdholländer'). Die Mühle wurde früher als
"Grundsegler" betrieben, da die Flügel fast bis auf den Erdhügel
herabreichten. Die Mühle hat zwei Zugänge, die aufgrund der
vorherrschenden Westwindwetterlagen im Süden und Norden angeordnet
sind. Der Hauptzugang im Südosten ist vom Hof aus über eine auf die
Erdanschüttung gesetzte Treppenanlage aus Ziegelsteinen zu erreichen.
Der zweite Zugang im Norden ist von der Gartenseite zu begehen. Versetzt
eingebaut in den Turmschaft sind kleine, hochformatige Fensteröffnungen,
die das Innere belichten. Die ursprünglich in den Wind drehbare Kappe
(Haube) ist erhalten und mit Bitumenschindeln eingedeckt. Der Wellenkopf
mit den vier Bruststücken zur Aufnahme der Flügel ist erhalten. Er
besteht aus Grauguss mit vier Öffnungen zur Aufnahme der Flügel. Die
Flügel selbst wurden nach Sturmschäden bis auf Reste der tragenden Flügelbalken
zwischen 1928 und 1938 abgenommen und an andere Mühlen verkauft. Die Flügelwelle
aus Holz ist erhalten. Sie liegt auf zwei Quarzsteinen. Das vordere
Halslager trug das gesamte Gewicht der Flügel, den Achskopf und einen
Teil der Flügelachse. Der hintere Lagerbolzen ist aus Metall gefertigt
und in der hölzernen Flügelachse befestigt. Damit bei wechselnden
Sturmwinden die Flügel und die Haube nicht abhoben, ist über dem
hinteren Flügellager ein Sicherheitseisen montiert.
Konstruktionsbedingt war die Haube kopflastig, was aber durch das rückwärtige
Krüwerk (Stert oder Sterz), mit dem sich die Haube in den Wind drehen
ließ, ausgeglichen wurde. Alle Zahnräder des Windantriebs, von der
Haube bis zu den Mahlgängen, wurden bei der Elektrifizierung im Jahre
1927 entfernt. Der Wellenkopf oder Achskopf besteht aus Grauguss mit
vier Öffnungen zur Aufnahme der Flügel. Ein Holzring bildet die
Unterseite der Kappe. Unter der Kappe schließt ein umlaufender Kranz
von Blausteinen den Schaft ab. Auch auf dem Blausteinkranz befindet sich
ein u-förmig gearbeiteter Holzring, in dem viele kleine Holzkugeln
laufen. Die Holzrollen ermöglichten das Drehen der Haube um 360 Grad in
den Wind. An der Ostseite des Mühlenturmes ist eine farbig gefasste
Statue des Hl. Johannes Nepomuk in einer Rundbogennische erhalten, darüber
befindet sich die inschriftliche Datierung 1733. Die Westseite des
Turmes zeigt Beschussschäden des Zweiten Weltkriegs. Das Innere ist in
vier Geschosse und einen Keller gegliedert. Teile der technischen
Ausstattung des Elektroantriebs der Mahlgänge blieben erhalten. Hierzu
gehören z. B. Transmissionsscheiben mit Wellen und Rädern unter dem hölzernen
Fußboden des 1. OG, die dem Betrieb der in späterer Zeit durch einen
elektrischen Schleifringmotor angetriebenen Mahlgänge dienten. Die
innere Erschließung erfolgt über steile Stiegen. Im 1. OG lagen ursprünglich
zwei Mahlgänge, von denen jedoch nur der Weizenmahlgang samt Boden- und
Läufersteinen erhalten geblieben ist. Im 2. OG lag ursprünglich
ebenfalls noch ein Weizenmahlgang. Als Mahlsteine dienten zuletzt sog.
'Franzosen'. Bei ihnen handelt es sich um Steine aus Süßwasserquarzit,
die aus La Ferte sous Jouarre in der Champagne stammen. Sie wurden daher
auch Champagnersteine genannt. Diese äußerst harten Steine wurden auch
in Motormühlen zum feinen Ausmahlen des Mehls verwendet und mussten
nicht so häufig wie andere Steine aus Sandstein oder Basallava
nachgeschärft werden. Der Läuferstein ist mit Eisenbändern und nachträglich
mit einem flachen, abgenutzten Basaltlava-Mühlstein zur Beschwerung
verbunden worden. Ein Steinkran samt Spindel, in dessen Greifarmen der Läuferstein
befestigt ist, diente zum Abheben des Läufers vor dem anschließenden
Schärfen beider Mahlsteine. Er ist bei diesem Mahlgang erhalten
geblieben. Das Objekt ist bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen und für die Geschichte der Arbeits- und Produktionsverhältnisse. Für seine Erhaltung und Nutzung liegen wissenschaftliche, insbesondere ortshistorische, bauhistorische und technikhistorische Gründe vor. |