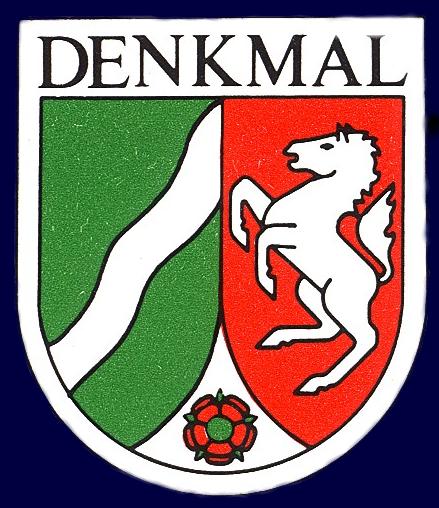Denkmalbeschreibung:
Geschichte
Am 15.7.1890 gründet Friedrich Schelkes eine
"Mechanische Buntweberei". Mit dem Teilhaber Reinhard Nottberg
leitet er die Firma sechs Jahre lang und gründet dann mit Unternehmer
Brand die "Viersener Buntweberei". Ab 31.8.1896 wird die Firma
Nottberg & Schelkes in "Nottberg & Sohn" umbenannt,
mit Reinhard und Adolf Nottberg als Teilhaber. Mitte März 1897 geht die
neue Firma in Betrieb.
Laut Ausweis der Bauakte errichtet der
Krefelder Architekt Joh. Reck für die Firma Nottberg & Sohn ab
Anfang 1900 eine neue "Mechanische Buntweberei" an der
Viersener Viktoriastraße. Der am 18.1.1900 eingereichte Bauantrag wird
bereits am 3.2.1900 genehmigt, am 17.7.1900 ist die Rohbauabnahme. Die
Betriebsaufnahme erfolgt vermutlich im Jahre 1901.
Laut Planung handelt es sich um eine Weberei
für 108 Webstühle nebst zugehörigem Kessel- und Maschinenhaus,
Vorbereitungssaal, Wiegekammer, Pflückraum, Dublierraum, Schlichterei,
Abort-, Wasch- und Essräumen sowie Lager-, Comptoir- und Wohngebäude.
Ab 1906 firmiert "Kohlstedt & Crone", "Duisburger
Buntweberei" als Eigentümer, der - wohl nach dem II. Weltkrieg -
von der "Seidenweberei Friedrich Wilhelm Greef" abgelöst
wird; von der der jetzige Eigentümer Joh. Gehlen das Anwesen erwirbt.
Beschreibung
Der heutige Baubestand der Weberei zwischen der Viersener Freiheits- und
Viktoriastraße entstand in zwei einheitlichen Baumaßnahmen 1900/1901
und 1922, wobei dem zweiten Bauabschnitt etwas geringere Bedeutung
zukommt. Beide Planungen sind - einige Vereinfachungen aus
Ersparnisgründen ausgenommen - ohne Abstriche verwirklicht worden und
haben bislang keine wesentlichen Veränderungen erfahren.
Die Front an der Viktoriastraße wird bestimmt
durch die rhythmische Felderteilung des Shedhallenbereiches der Weberei,
dem straßenseitig eine im Bereich der Erweiterung undurchfensterte, im
Bereich des Baues von 1900/1901 fünffach durch Lisenen geteilte, durch
Fenster belichtete Lagerraumwand vorgeblendet ist. Die höhergezogene
Außenwand verbirgt nach der Manier der Zeit die sägezahnartige
Dachgestalt der Shedhallen durch eine Attikazone. Den 1900/1901
errichteten Bauteil kennzeichnet eine außergewöhnlich reiche
Gestaltung: Lisenen, Neben- und Hauptgesims sind durch hellfarbig rote
Backsteine vom dunkleren Grund abgesetzt. Das Hauptgesims wird von
dreipaßähnlichen Formsteinen in gotisierender Dreiecksanordnung
gebildet. In den hellen Grund eingelassene Backsteinmotive ebenso wie
dunkle Ornamente auf hellem Grund verstärken den Eindruck einer auf die
Hauptansichtsseite der Fabrik (Viktoriastraße) ausgerichteten
repräsentativen Gestaltung.
Südlich an die Sheddachzone anschließend
erhebt sich über dem durchgezogenen Grundgeschoss das
zweieinhalbgeschossige Comptoir- und Wohngebäude. Hellere Lisenen und
Gesimse - auch hier wieder gotisierend - gliedern den dreiachsigen Bau.
Das mit spitzbogigen Blendmotiven verzierte Giebelhaus wird flankiert
von zwei kleineren, ebenfalls reichgezierten Dachgauben. Die Südfront
seitlich zur Werkseinfahrt springt nach einer dreiecksübergiebelten
Achse zurück. Es folgen die Eingangs- sowie eine von Ochsenaugen
durchfensterte weitere Achse. Auch das über den rückwärtigen Anbau
hinausragende Obergeschoss des Wohngebäudes ist in einer der
Hauptansichtsseite in nichts nachstehenden Aufwendigkeit gehalten. An
der ost-westlich verlaufenden Erschließungsstraße folgt ein
eingeschossiger Flachbau für die Wasch-, Ess- und Abortanlagen. Er
springt nach drei Achsen rechtwinklig, nach einer weiteren Achse mit
Viertelkreisprofil vor, um nach weiteren, den Werkseingang für die
Arbeiter umfassenden drei Achsen erneut in zwei Stufungen
zurückzutreten. Nach den letzten zwei Achsen (alle zehn Achsen sind mit
Stichbogenfenstern bzw. der Toranlage durchbrochen) springt dann das
ebenfalls ost-westlich verlaufende längsrechteckige Kesselhaus nach
Süden vor. Parallel ist diesem auf der nördlichen Längsseite das
Maschinenhaus angebaut. Beide verfügen über firstüberspannende
Lüfteraufsätze, der des Maschinenhauses kurzer als der Aufsatz des
Kesselhauses. Die Stirnwände beider Bauten schmücken Rauten- und
Dreiecksfelder. Letzteren sind Stufenmotive einbeschrieben. Alle
eingetieften Schmuckfelder weisen klötzchenfriesartige Zierate aus
hellen Backsteinen auf dunklem Grund auf. Die äußeren Längswände der
Doppelanlage sind durchfenstert.
Im Westen des Kesselhausteiles folgt
freistehend der quadratische Schornsteinsockel, der über einer
oktogonalen Übergangszone in den zylindrischen Schornsteinschaft
übergeht. Sockel- und Gesim-szone sind ebenfalls mit Treppenfriesen in
hellem Backstein geziert, der Schornstein selbst weist am unteren und
oberen Ende flächig-dreieckig, quasi textile, hellrote Schmuckmotive
auf.
Die heutige Front zur Freiheitsstraße zeigt
offen die Sheddachprofile. Die Wandflächen sind hier stufenförmig
gegliedert und tragen Ornamentschmuck in hellem Backstein.
Nach drei Shedstaffeln folgt im Norden die 1922
angefügte Erweiterungszone, die sowohl zur Freiheits- als auch zur
Viktoriastraße hin horizontale Dachabschlüsse zeigt. Die vierteilige
Ansicht zur Viktoriastraße ist nicht durchfenstert und weist eine mit
flachen Lisenen und Gesimsen gebildete einfache Gliederung auf.
Im Inneren der Gebäude ist, was das Wohn- und
Comptoirgebäude anbelangt, die originale Fensterausstattung
hervorzuheben. Der drei Shedzüge umfassende Websaal von 1900/1901 zeigt
drei zehn Stützen umfassende Folgen von Gußeisenpfeilern, die vier
Sheddachstaffeln der Erweiterung von 1922 haben genietete
Stahlprofilstützen. Maschinell-technische Einrichtungen wie
Transmissionen, Dampfmaschinen oder Webstühle sind nicht erhalten.
Bewertung
Bei der unter Il aufgeführten Anlage der ehemaligen Buntweberei
Nottberg & Sohn von 1900/1901 mit dem Erweiterungsbau von 1922 für
die Duisburger Buntweberei Kohlstedt & Crone handelt es sich im
beschriebenen Umfange um ein Denkmal im Sinne des § 2 Abs. 1
Denkmalschutzgesetz NRW. Die Anlage ist bedeutend für die Städte und
Siedlungen und für die Entwicklung der Arbeits- und
Produktionsverhältnisse. Für Erhaltung und Nutzung liegen
künstlerische, wissenschaftliche und städtebauliche Gründe vor.
Der Erhaltungszustand der Gesamtanlage ist als
außergewöhnlich zu bezeichnen. Die ursprüngliche Baugestalt ist fast
volkommem unbeeinträchtigt von Um- und Anbauten geblieben, ein für
Bauten des Gewerbes und der Industrie höchst seltener Fall. Die 1922
vorgenommene Erweiterung fügt sich unter Nutzung der fortgeschrittenen
technischen Errungenschaften (Stahlprofil- statt Gußstützen) in
Gestaltung und Gliederung nahtlos an den ursprünglichen Bau an.
Insbesondere die Firmenansicht von der Viktoriastraße aus bietet hoch
heute die Wahrnehmungsmöglichkeit einer kleinen, für Viersen einst
charakteristischen Textilfabrik mit dem eingeschossigen Websaal hinter
repräsentativer Straßenfront nebst Verwaltungs- und Wohngebäude. Von
der Freiheitsstraße aus sind dann die übrigen typischen Elemente eines
derartigen Betriebes ohne Mühe wahrnehmbar: Kessel- und Maschinenhaus
samt zugehörigem Schornstein sowie die hier funktional-unverhüllt
(ursprünglich auf einen Nebenweg weisend) behandelte Shedfront.
Hervorzuheben ist am gesamten Komplex die weit
über dem Durchschnitt liegende Prächtigkeit der Baugestalt. Diese
tritt nicht nur im reich ornamentierten Wechsel des Backsteinmaterials
mit seinen flächigen und plastischen Schmuckmotiven (besonders auch am
Schornstein) zutage. Der Haupteingang des Werkes an der Südseite ist
vielmehr in seltener Weise in einer nahezu neobarock zu nennenden
Grundrissgestalt ausgebildet, wie sie in dieser Form nicht häufig
anzutreffen ist. Die Südseite ist in einer der Ostfront an der
Viktoriastraße nicht nachstehenden Art und Weise als vollgültige
Ansichtseite behandelt worden. Die ehemalige Buntweberei Nottberg &
Sohn ist damit in exemplarischer Weise Denkmal der strukturprägenden
Textilindustrie Viersens in der Erscheinungsform der Jahrhundertwende.
Zusammen mit der nahegelegenen fünfzig Jahre älteren Baumwollspinnerei
Goeters in der Gereonstraße ist damit der wichtigste Industriezweig der
Stadt in zwei wesentlichen wirtschaftsgeschichtlichen Epochen
dokumentiert. Die Anlage zwischen Viktoriastraße und Freiheitsstraße
charakterisiert dabei den in voller Blüte stehenden Historismus und
Eklektizismus des Industriebaues der Jahrhundertwende mit ihrem Reichtum
an neogotischen und neubarocken Elementen der Außenerscheinung,
während die Disposition der einzelnen Werksteile - Krafterzeugung,
Arbeitsflächen, Verwaltung und Wohnen - den Stand der Technologie der
Zeit widerspiegelt. Dies gilt ebenso für die Erweiterung der 20er
Jahre, die sich unter Verwendung modernerer Bautechnik gestalterisch der
bestehenden Anlage anfügt. Reichtum der Erscheinungsform und nahezu
originalgetreuer Erhaltungszustand neben dem Vorhandensein aller
ursprünglichen Architekturelemente machen die ehemalige Buntweberei zu
einem vollgültigen Industriedenkmal.