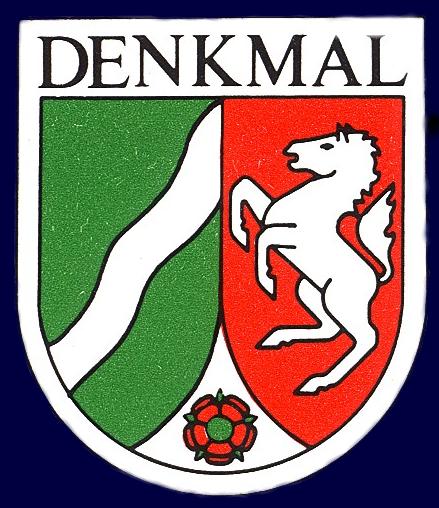Saalbau Gaststätte
"Königsburg" in Süchteln

Denkmalbeschreibung:
Geschichte
Im Jahre 1908 lässt Willy Schmitz den Saalbau "Königsburg"
errichten, der dann im Verlauf vieler Jahre gesellschaftliche Höhepunkte
erlebt. Konzert-, Tanz- und Bühnenveranstaltungen ergänzen sich in
steter Reihenfolge. Die örtlichen Theatergesellschaften und
Gesangsvereine feiern in der "Königsburg" glanzvolle Aufführungen
und Feste. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verringert das
Veranstaltungsangebot. Bald dient der Saal vorübergehend
Wehrmachtsgruppenteilen als Quartier und in den letzten Kriegsjahren
bewohnen deportierte Fremdarbeiter die "Königsburg". Trotz
aller widrigen Umstände und der miserablen wirtschaftlichen Lage in den
Nachkriegsjahren verspüren auch die Menschen in Süchteln neuen
Lebensmut und suchen wieder Unterhaltung und Vergnügungen.
Allerdings zeigt sich in den ersten
Nachkriegsjahren auch unverkennbar schnell eine Trendwende zum
"Geliebten Kino". Die Saalveranstaltungen werden weniger, die
Wirtschaftlichkeit eines Saalbaues ist nicht mehr gegeben.
Unter Federführung des Düsseldorfer Architekten A. Nehaus entsteht
1951 ein neuzeitliches Lichtspieltheater, verbunden mit einer
ausgezeichneten Akustik und modernen Philips-Tonfilmapparaturen. Das nun
bekannt gewordene Süchtelner Lichtspielhaus erlebt in den 50iger Jahren
einen wahren Zuschauerboom.
Die Kino-Ära ist leider viel zu kurz. Ende der 60iger Jahre beginnt das
große "Sterben der Lichtspielhäuser". Auch die "Königsburg"
bleibt davon nicht unbetroffen und so wird im Jahre 1972 das Süchtelner
Kino geschlossen.
Beschreibung
Der Saalbau der an der Hochstraße gelegenen Gaststätte "Königsburg"
ist im rückwärtigen Hofbereich, angrenzend an die Irmgardisstraße, zu
finden. Der Außenbau in Putz-Backstein ausgeführt zeichnet sich durch
funktionelle Schlichtheit aus, verzichtet dabei aber nicht auf eine repräsentative
Gestaltung der Eingangsfassade mit zeittypischem Dekor. Die im
Jugendstil gehaltene Fassade weist im Erdgeschoss eine zweiflüglige
Saaleingangstür mit sprossenunterteiltem Oberlicht auf. Die Holztüren
sind mit geometrischen und floralen Ornamenten geschmückt. Zu erreichen
ist das Erdgeschoss über eine Freitreppe mit beidseitigem Eisengeländer,
das mit verschiedenen geometrischen Ornamenten verziert ist. Das
Obergeschoss, mit einem über die gesamte Hausbreite versehenen Balkon,
weist eine funktionelle Aneinanderreihung von Fenster und Türen auf.
Die repräsentative Eingangshalle findet ihren Abschluss in einem leicht
segmentbogenförmig abgetrepptem Ziergiebel, der mit einem im Jugendstil
gehaltenen Ornament geschmückt ist.
Das Saalgebäude/ebenfalls von der Irmgardisstraße zugänglich, weist
eine Backstein-Putzfassade auf, wobei der rote Backstein dominiert.
Architektonisch reizvoll zeigt sich im Fensterbereich das Wechselspiel
zwischen Putzflächen und rotem Backstein.
Die zwei dreiflügligen sprossenunterteilten Fenster sind mit einem
Flachbogen versehen. Das Dachgesims wird betont durch ein Zahn- und Würfelfries.
Das Saalgebäude wird in seinem Innern geprägt
durch den rechteckförmigen Saal mit den abgerundeten Ecken im
Wand-Deckenbereich und die in Bogenform gehaltene Decke, die für eine
hervorragende Akustik sorgt. Der eher funktionell ausgestattete Saal mit
seiner Bühne und Leinwandfläche sowie einem höher liegenden
Bildwerfer- und Schaltraum weist im Deckenbereich rosettenähnliche und
geometrische Ornamente auf, die die Deckenform betonen.
Der neben dem Saal in Richtung Irmgardisstraße befindliche Vorraum
weist einerseits einen Ausgang zur Irmgardisstraße auf und andererseits
ist dort der Kellerabgang zu finden.
Der Saalbau erfährt seine Bedeutung als
Beispiel eines Bautyps, der im Innern im wesentlichen erhalten ist und
architekturgeschichtlich interessante Details besitzt. Der Außenbau
zeichnet sich durch funktionale Schlichtheit aus, verzichtet dabei aber
nicht auf eine repräsentative Gestaltung der Eingangsfassade mit
zeittypischem Dekor.
Die Innenarchitektur des Kinosaales zeigt sich in der Formensprache der
frühen 50iger Jahre mit den abgerundeten Ecken im Wand-Deckenbereich
und die von der Akustik bestimmte bogenförmige Decke.
Aus wissenschaftlichen, insbesondere
architekturgeschichtlichen, ortsgeschichtlichen und
sozialgeschichtlichen Gründen liegen Erhaltung und Nutzung des
Saalbaues der Gaststätte "Königsburg" gemäß § 2 (1) des
Denkmalschutzgesetzes im öffentlichen Interesse.