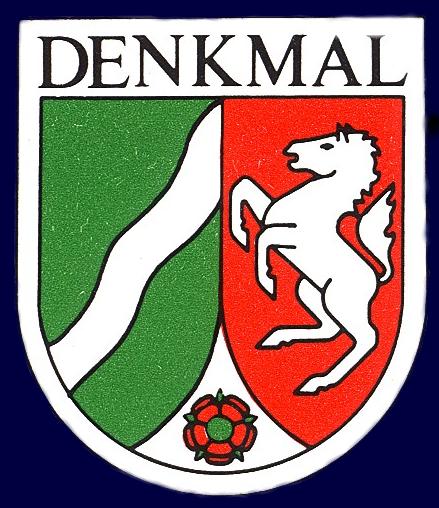|
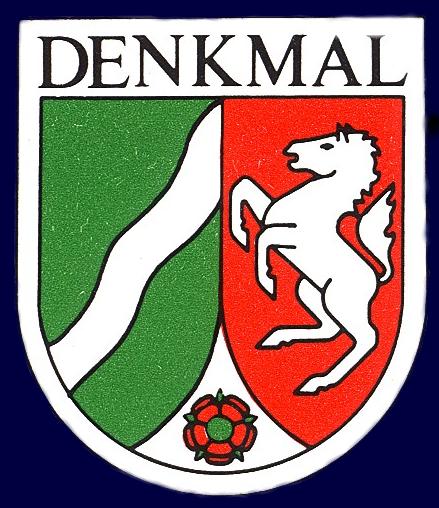
Standort:
Heierstraße 2, D 41747 Viersen
GPS:
51o 15'
09,9"
N 06o
23' 34,6"
O
Zuständigkeit:
Privat
Baujahr:
1901
Tag der Eintragung als Denkmal 18.
April 2002
Quellenhinweis:
Beschreibung der Denkmalbehörde
|
|
Nationaltheater (Kino)
in Viersen

Denkmalbeschreibung:
Geschichte
Der Eigentümer des "Viersener Hofes" (Gladbacher Straße 1),
Wilhelm Pesch, läßt 1901 auf einem Nachbargrundstück an der Heierstraße
einen Saal an seine Gaststätte anbauen. Den Entwurf für diesen bei
seiner Eröffnung als "größter und schönster Saal Viersens"
(Zart, S.25) bezeichneten Bau ("Kaiser-Friedrich-Halle")
lieferte der Bauunternehmer Johann Peerlings. Ursprünglich gehören
noch eine Veranda und Gartenanlagen dazu. 1914 erfolgt der Umbau zu
einem Kino, dessen Eingang und technische Infrastruktur 1927 und noch
einmal 1928 erneuert wurden, zuletzt nach einem Plan des bekannten, auf
den Kino- und Theaterbau spezialisierten Düsseldorfer Architekten Ernst
Huhn.
Beschreibung
Erste Planzeichnungen sehen zunächst einen eingeschossigen Flachbau
vor, bevor vielleicht auch städtebauliche Gründe zu einer Änderung im
Sinne der dann ausgeführten repräsentativen Giebelfassade mit
Steildach führen. Heute präsentiert sich der Bau im Inneren vollständig
verändert und mit dem Nachbargebäude Gladbacher Straße 1 durchgebaut.
Erhalten geblieben ist jedoch die aufwändige, straßenbildprägende
Schmuckfassade, deren Großform bereits den Bautyp widerspiegelt, zumal
im Zusammenhang mit dem benachbarten Gaststättengebäude.
Das Erdgeschoss ist vier Achsen breit, wobei
der linke, flach gedeckte Teil ehemals lediglich eine Garderobe und die
Verbindung zur Gaststätte darstellte. Der eigentliche Saalbau erhebt
sich drei Achsen breit mit Mitteleingang. Seinem Dachraum ist ein hoher,
seitlich geschweifter und dreieckig endender Giebel vorgeblendet. Die
Fassade ist durch Lisenen, Geschossgesims und Bänderungen kleinteilig
strukturiert. Das Erdgeschoss besitzt eine Putzbänderung, während der
Giebel glatt verputzt ist. Die großen Fenster- und Türöffnungen haben
korbbogige profilierte Putzrahmungen mit ornamentierten Keilsteinen, der
Eingang ist gegenüber dem ursprünglichen Entwurf mehrfach, erstmals
bereits für die Kinonutzung verändert (verbreitert) worden, sein
Bogenabschluss ist heute eingezogen über der Öffnung aufgestelzt.
Bemerkenswert ist die feingliederige Ornamentierung mit stuckierten
Pflanzen und Blüten auf den Keilsteinen und in den Zwickelfeldern der Bögen.
Fenster und Türen sind modern erneuert, in der
linken Achse wurde das Fenster in einen zusätzlichen Eingang
umgewandelt.
Die ornamentale Detaillierung der Fassade wird
über dem strukturell eher konventionellen Erdgeschoss am Giebel noch
gesteigert. Dass die Ausführung dabei nicht immer exakt dem
Entwurfsplan von 1901 entsprach, legen einige vorhandene, höchst
wahrscheinlich originale Abweichungen (Brüstungsgesims; Giebelnische)
nahe. Außer den Lisenen, die ehemals in Akroterien enden, gliedern dünne
Bänder die Fläche. Den beiden Lisenen der Eingangsachse sind
dreieckige Stäbe auf Konsölchen vorgeblendet, die ebenfalls
akroterartig über die Giebelfront hinausragen und dort in zinnenförmige
Aufsätze, welche den Giebelabschluss rahmen, übergehen. Über dem kräftigen
Geschossgesims setzt zunächst ein Rundfenster mit vier Keilsteinen die
Auszeichnung der Eingangsachse mit besonderen Schmuckelementen fort.
Unmittelbar auf dem oberen Keilstein sitzt eine vasenförmige Konsole
auf, um die eines der aufgelegten Dreiecksbänder verkröpft ist. Sie
dient einem kleinen Putto vor einer flachen Nische als Plafond. Diese
Nische wird von zwei Halbsäulen gerahmt, die ebenfalls auf Konsölchen
aufsitzen. Sie scheinen ein liegend rechteckiges Feld zu tragen, das
vollständig mit vegetabilem Ornament gefüllt ist und in seiner Mitte
ein Wappenschild trägt. Ähnliche, kleinere Felder befinden sich links
und rechts der Eingangsachse am dortigen Giebelschweif. Auch kleine
Dreieckszwickelfelder in der Giebelspitze zeigen das gleiche vegetabile
Ornament. In den Giebelfeldern seitlich der Eingangsachse befinden sich
jeweils ein kleines, flach segmentbogig geschlossenes Fenster, deren
Grundform aber durch breite profilierte Putzrahmen, drei obere
Keilsteine, eine kräftig hervortretende Sohlbank sowie stuckierte Brüstungsfelder
stark verunklärt ist.
Denkmalwert
Da das Innere des Saalgebäudes durchgreifend modernisiert und umgebaut
ist, beschränkt sich der Zeugnis- und damit Denkmalwert auf die
Fassade.
Ihre überaus detailreiche ornamentale
Ausgestaltung zeugt von dem Anspruch, der mit diesem Bauwerk verbunden
war und der ja in der Tat in der zeitgenössischen Bewertung als
"schönster Saal Viersens" mündete. Im zeitgenössischen,
noch ganz historistisch geprägten Verständnis konnte dieses
Anspruchsniveau in einer Häufung unterschiedlicher, überwiegend
renaissancistischer Formen und Stilzitate zum Ausdruck gebracht werden.
Eher flächenhafte, mehr mit Proportion als mit Detailapplizierung
arbeitende Würdeformen, wie sie die moderne Reformarchitektur kurze
Zeit später favorisiert, sind dieser Architekturauffassung noch fremd.
Auch wenn das Innere der ehemaligen "Kaiser-Friedrich-Halle"
als historisches Zeugnis verloren ist, repräsentiert die Fassade mit
ihrem guten Erhaltungszustand diese architekturgeschichtliche Stellung
in anschaulicher Weise. Die vereinzelten späteren Veränderungen beschränken
sich auf untergeordnete Details und respektieren formal und materiell
den ursprünglichen Formgedanken.
Von ortsgeschichtlicher Bedeutung ist der
Saalbau zunächst als Veranstaltungsort und Teil der bekannten Gaststätte
"Viersener Hof", dessen Größe und Gestalt bereits zeitgenössisch
als bedeutend gelten. Hinzu kommt dann 1914 die Umwandlung in ein Kino,
womit er zu den heute selten gewordenen frühen Einrichtungen dieser
Gattung gehört.
Nach überblickshaften Recherchen im
Stadtarchiv und mündlichen Auskunft von Zeitzeugen (Herr Willy Bours/Herr
Dr. Franz Zevels) gibt es in Viersen vor dem Ersten Weltkrieg mindestens
drei oder vier feste Filmvorführstätten. Ein erster Hinweis auf ein
kinematographisches Lokal - Phono-Kinematoskopie-Theater - stammt aus
dem Jahr 1909 (Ecke Haupt-/Wilhelmstraße), das "Kaiserkino"
im Hotel Krefelder Hof ist 1911 belegt, das "Lichtspielhaus",
später "Schauburg" an Augustaplatz gegenüber dem Amtsgericht
1913. Andere Namen von Kinos - "Volks-Theater",
"Kaiser-Kino", "Apollo-Theater" "Allhambra-Theater",
"Kammerspiele" und "Nationaltheater" - die alle den
Standort Neumarkt aufweisen, sind nach derzeitigem Kenntnisstand wohl
auf das hier angesprochene Gebäude in der Heierstraße zu beziehen. Die
ersten öffentlichen Filmvorführungen nach 1895 finden zunächst als
Wander- oder Jahrmarktkinos statt. Eine zweite Entwicklungsphase wird in
Deutschland ab etwa 1910 angesetzt, als zunehmend feste Spielstätten
entstehen, meist umgebaute Säle, aber auch schon erste nur für diesen
Zweck errichtete Neubauten. Diese "Sesshaftwerdung" vollzieht
sich zuerst in den Städten, wo ein ausreichendes Stammpublikum
vorhanden ist. Zu dieser zweiten, immer noch sehr frühen Phase der
Entwicklung der Kinoarchitektur ist also auch das Lichtspieltheater in
der Heierstraße zu zählen. Der Durchbruch als eigenständige
Baugattung, teilweise sogar mit Leitbildfunktion für die Moderne, zeigt
sich dann erst in den zwanziger Jahren.
Im Zusammenhang mit dem benachbarten, auch
funktional zugehörigen Eckgebäude Gladbacher Straße 1, der ehemaligen
Gaststätte "Viersener Hof", und dem daran anschließenden
Wohn- und Geschäftshaus Gladbacher Straße 3 bildet die Fassade der
ehemaligen "Kaiser-Friedrich-Halle" einen der markantesten
historischen Blickpunkte in der Viersener Innenstadt aus. Gleichzeitig
bildet sie den Übergang von der höheren Hauptstraßenbebauung in die
insgesamt niedrigere Heierstraße, welche noch eine hohe Dichte
historischer Bausubstanz aufweist. Ihrer originellen Baugestalt kommt so
auch erhebliche städtebauliche Bedeutung zu.
Die straßensichtige Giebelfassade des Gebäudes
Heierstraße 2, ehemals "Kaiser-Friedrich-Halle" ist als
wichtiger, prominent gestalteter Saalbau und dann als frühes Kino in
zentraler Lage bedeutend für Viersen. An seiner Erhaltung und Nutzung
besteht aus den dargelegten wissenschaftlichen, insbesondere
architektur- und ortsgeschichtlichen sowie aus städtebaulichen Gründen
ein öffentliches Interesse. Gemäß § 2 (1) Denkmalschutzgesetz NRW
handelt es sich daher um ein Baudenkmal.
|