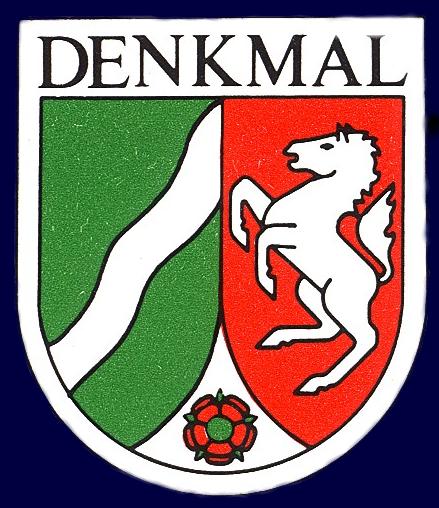Villa Maria in Viersen

Denkmalbeschreibung:
Lage und Entstehung
Das Haus Gladbacher Straße 779 befindet sich an der südlichen
Stadtgrenze Viersens (neben der Landwehr) und schließt dabei praktisch
unmittelbar an die zu Mönchengladbach gehörende Bebauung an bzw. wird
häufig auch als dieser zugehörig betrachtet. Selbst in den zeitgenössischen
Bauanträgen ist die Straßenbezeichnung teilweise unklar
("Viersener Landstraße zu Helenabrunn"). Bauherr und
Architekt stammten aus Mönchengladbach und hatten dort auch ihren
Lebens- und Arbeitsmittelpunkt. Das Haus wurde 1911-12 für den
Fabrikanten Ernst Essers errichtet, der Entwurf stammt von dem
Architekten und Bauunternehmer Johannes Heuter.
Beschreibung
Es handelt sich um ein freistehendes, hinter einem Vorgarten mit
Einfriedung von der Straße abgerücktes Wohnhaus (Villa), wobei die
rechte Seite als fensterloser Brandgiebel ausgeführt und somit auf den
späteren Ausbau zu einer "Doppelvilla" hin konzipiert wurde.
Der im Prinzip rechteckige Baukörper erhebt sich zweigeschossig mit
ausgebautem Dachgeschoss auf annähernd quadratischer Grundfläche (ca.
12,00 x 10,30 m). Der Außenbau ist über einem Sockel mit Putzquaderung
glatt verputzt und zeigt nach vorne und zur linken Seite hin eine in
zeittypischer Weise "malerisch" gegliederte Dach- und Baukörpergestaltung.
So sind im Erdgeschoss nach vorne ein kleiner dreiseitiger Erker und
seitlich ein Eingangsvorbau angefügt, beide mit leicht abgeschleppten
Dachflächen. Im Obergeschoss kragt auf der linken Hausecke eine Loggia
leicht hervor, die mit Säulen geöffnet ist und ebenfalls ein
abgeschlepptes Walmdach trägt. Das ausgebaute Dach prägen nach vorne
ein firsthoher, zur Seite ein niedrigerer Zwerchhausgiebel, wobei die Fläche
in der Giebelspitze jeweils verschiefert ist; auch die Wandfläche im
Dachgeschoss zwischen den beiden Giebeln ist verschiefert, was optisch
den Eindruck eines Mansarddaches hervorruft. Das eigentliche Walmdach
besitzt auf seinen Ansichtsseiten eine Biberschwanzdeckung.
Innerhalb der aufgehenden verputzten Wandfläche sind die
hochrechteckigen Fenster an verschiedenen Stellen zu Gruppen
zusammengefasst, die teilweise auch durch gemeinsame, teils gerundete
Gewände verbunden sind. Regelmäßige vertikale Fensterachsen sind
vermieden. Im Obergeschoss und teilweise im Dachgeschoss sind grüne
Fensterländen vorhanden. Die Wandflächen werden ferner durch eine
Kassettierung der Loggiabrüstung sowie durch eine kleine Inschrift
"Villa Maria" zwischen Ober- und Dachgeschoss gegliedert. Der
Name leitet sich vom Vornamen der Ehefrau Ernst Essers ab.
Die Rückseite des Hauses ist insgesamt schlichter ausgeführt, mit
einem einfachen Zementputz versehen und mit einer traufständigen
Satteldachfläche, auf der zwei Schleppgauben für die Belichtung des
Dachgeschosses sorgen.
Neben dem einschließlich der Fenster gut
erhaltenen Äußeren besticht das Haus Gladbacher Straße 779 vor allem
durch das weitgehend unveränderte Innere, mit noch dazu einigen
bemerkenswerten Ausstattungselementen wie den zahlreichen originalen
Buntglasfenstern der Bauzeit. Hinter dem Eingang mit alter Haustür
liegt das Treppenhaus, von dem aus durch einen mittig gelegenen,
firstparallelen Stichflur die Zimmer in den einzelnen Geschossen
erschlossen werden. Im Erdgeschoss waren laut Bauplan Salon, Esszimmer
und "Veranda" (ein weiterer Wohnraum) vorgesehen, dabei die
vorderen Zimmer durch breite Durchgänge miteinander verbunden; im
Obergeschoss verzeichnet der Plan Schlafzimmer, Bad und Comptoir, im
Dachgeschoss weitere Schlafzimmer, Fremden- und Mädchenzimmer.
Die Treppe führt dreiläufig nach oben, das Metallgeländer ist
ornamental gestaltet. Bodenfliesen bzw. -dielen sind erhalten. Den
Treppenaufgang begleiten Farbfenster mit pflanzlich-ornamentalen
Motiven, in die Details wie Messuhren oder Zirkel und Dreieckslineal
eingefügt sind, die auf den technischen Beruf des Bauherren hindeuten.
Auf dem Obergeschoss-Absatz befindet sich ein motivgeschichtlich ganz
besonderes, dreiteiliges Buntfenster, in dem zentral Inschriften
angebracht sind, die neben dem Hausherren auch die Bauzeit am Beginn des
Ersten Weltkrieges widerspiegeln: "Wir Deutschen niemals untergehn
/so lange wir Granaten drehn / und Schmiede Waffen hämmern",
darunter links und rechts die Jahreszahlen 1914 bzw. 1915 und in der
Mitte zusätzlich eine Granate mit dem Berufssignet Zirkel und Dreieck.
Türen (Rahmenfüllungstyp, häufig durchfenstert), zugehörige Gewände
sowie Bodenbeläge sind an vielen Stellen im Haus erhalten (z.B. Fliesen
in Erdgeschoss-Flur, Küche bzw. Bad), ebenso aufwändige Leuchter
(Treppenhaus) und Deckenstuckierungen in den Haupträumen (ehemals
Wohn-/Esszimmer des Erdgeschosses, Wohn-/Schlafzimmer des
Obergeschosses). Diese sind der Bauzeit gemäß stärker
abstrahiert-geometrisch aufgefasst als zuvor im Historismus üblich und
nach Raumtyp differenziert: z.B. Rokokomotive im ehemaligen Salon, an
Renaissance-Kassettendecken angelehnt im ehemaligen Esszimmer,
Wabenmuster im ursprünglich als "Veranda" bezeichneten
Zimmer. Auch im ehemaligen Esszimmer und im "Veranda"-Zimmer
sind in den dreiseitigen Erkerausbauten Buntglasfenster angebracht, die
z.T. wieder Inschriften enthalten ("Arbeit ist des Bürgers
Zierde" / Hier leb ich, hier lieb ich, hier ruhe ich aus" /
"Hier ist meine Heimat, hier bin ich zu Haus").
Weitere bemerkenswerte Ausstattungsdetails der Bauzeit sind die
kaminartig gestaltete Heizstelle und der Leuchter im Erdgeschoss des
Treppenhauses.
Die zeitgenössische Einfriedung mit Portal ist
zwar leider ohne Gitter überliefert, zählt aber funktional und
stilistisch selbstverständlich zum historischen Bestand.
Bauherr
Ernst Essers wurde am 16.08.1870 in Krefeld geboren und ist am
01.03.1947 in Mönchengladbach gestorben. Nach den Recherchen des
Stadtarchivs Mönchengladbach ist er 1893 aus Cottbus nach Mönchengladbach
zugezogen, in das Haus seines Vaters Otto Essers (Regentenstraße 93),
der zusammen mit seinem Bruder Ernst eine Mechanische Weberei
"Gebr. Essers" an der Eickener Straße 196/198 betrieb.
Ernst Essers wird 1902 und 1906 als Inhaber der Firma "Gladbacher
Eisengießerei Ernst Essers" verzeichnet, Lürriper Str. 390a (im
Adressbuch 1907 erscheint unter dieser Adresse auch Otto Essers, als (Mit-)Besitzer?).
Hauptprodukte der Gießerei waren laut einem Briefkopf aus dem Jahr 1911
Bauguss, Stahlformguss, Eisenkonstruktionen, Zirkulieröfen,
Zirkulier-Koksöfen und Diaphragmapumpen "System Essers". Die
Adressangaben bezüglich seines Firmensitzes und seiner Wohnung sind über
die Jahre etwas verwirrend, da offenbar auch auf den geschäftlichen
Briefköpfen in der Regel seine private Adresse und Telegrafen-Nummer
angegeben sind. Vor dem Umzug nach Viersen scheint seine Privatadresse
wohl Poeth 25 gewesen zu sein (so jedenfalls die Adressbücher 1908 und
1912). Auffällig ist auch, dass Ernst Essers spätestens mit dem Ersten
Weltkrieg nicht mehr als Inhaber einer konkreten Fabrik in den Adressbüchern
erscheint, sondern z.B. im Viersener Adressbuch 1927 als - im
Handelsregister eingetragener - "Ingenieur" (1908:
"Zivil-Ingenieur").
Essers scheint schon im Ersten Weltkrieg nicht mehr Besitzer der
Eisengießerei an der Lürriper Straße in Mönchengladbach gewesen zu
sein. 1916/17 sind für die Lürriper Straße 390/390a im Adressbuch ein
Andreas Schlipper und ein Hubert Philippen angegeben, bevor hier 1921/22
und 1925/26 die Firma Lomberg & Söhne, Metallwarenfabrik u.
Eisenhandlung und dann erstmals 1927 "H. Weller,
Eisenkonstruktionen" angesiedelt sind, letztere unter dem Namen
"Stahlbau Weller" lange Jahre ein großes und bekanntes
Unternehmen.
Welcher unternehmerischen Tätigkeit Ernst
Essers nach dem Ersten Weltkrieg nachgegangen ist bzw. ob er weitgehend
von Patenten und Kapital leben konnte, ist derzeit nicht genau bekannt.
Als letzte Adresse vor seinem Tod erscheint nach dem Zweiten Weltkrieg
schließlich die Viersener Straße 450 in Mönchengladbach: Nach dem Tod
seiner Frau Maria wurde er dort von den Ordensschwestern des gegenüber
der Villa liegenden Franziskushauses versorgt, im Gegenzug diente die
„Villa Maria" dem Orden als Wohnhaus. Im Franziskushaus ist
Essers dann 1947 auch verstorben.
Architekt
Zu Leben und Werk des Mönchengladbacher Bauunternehmers und Architekten
Johannes Heuter (gest. 1963) ist wenig bekannt, was in erster Linie
daran liegen mag, dass in Mönchengladbach die historischen Baukaten im
Zweiten Weltkrieg vernichtet wurden. Der bislang früheste Bau, der der
Denkmalpflege bekannt ist, ist das Wohnhaus Am Alten Rathaus 4 in
Viersen-Dülken, errichtet 1904 für den Schuhfabrikanten Gerhard
Gatzenmeier. In Viersen erbaute er 1905 das Wohnhaus mit Weinbrennerei
von Josef Fausten, Rektoratstraße 39. Nachdem Heuter im Adressbuch 1906
unter der Adresse Regentenstraße 112 verzeichnet ist, findet man ihn
dort 1921/22 unter der Adresse Luisenstraße 167 - sehr wahrscheinlich
ist die 1908/09 errichtete, denkmalgeschützte Bautengruppe Luisenstraße
167-173 daher ebenfalls von ihm, ebenso das Haus Hohenzollernstraße
185, für das im Adressbuch als Bewohner allerdings Heinrich Heuter
angegeben ist. Johannes Heuters Adresse in den 1920er und 1930er Jahren
lautete Franziskanerstraße 10, 1950 bis zu seinem Tode dann Rubensstraße
9.
Die Heuter gesichert zuschreibbaren Bauten vor
dem Ersten Weltkrieg weisen ihn als einen Architekten aus, der "auf
der Höhe der Zeit" den Reformstil jener Jahre sicher anwendete,
der sich mit Mitteln des Jugendstils und Neuer Sachlichkeit evolutionär
vom Historismus löste. Während es sich bei den Häusern in Luisen- und
Hohenzollernstraße um einfache eingebaute Reihenhäuser handelt, sind
das Dülkener Wohnhaus und die „Villa Maria" typische
Unternehmerwohnhäuser, wobei letztere durch ihren Ausstattungs- und
Detailreichtum sicher eine Sonderstellung einnimmt.
Denkmalwert
Die „Villa Maria" des Unternehmers Ernst Essers, Gladbacher Staße
779, ist aufgrund ihres außergewöhnlich weitgehenden Originalzustands,
der Qualität ihrer Gestaltung und ihres Ausstattungsreichtums als eines
der herausragenden architektonischen Zeugnisse Viersens aus der Zeit vor
dem Ersten Weltkrieg anzusehen. Auffallend sind stilistische Anleihen
beim zeitgenössischen "neubergischen Bauen", das sich in der
Verschieferung, der Gestaltung der Fenstergewände (weiß aufgeputzt mit
runden Fensteröffnungen) und den grünen Fensterläden, insgesamt also
auch dem farblichen Dreiklang weiß-grün-schwarz ausdrückt. Die mündliche
Überlieferung, diese für den Niederrhein eher untypische Gestaltung
sei wegen eigener biografischer Wurzeln im Bergischen Land auf Wunsch
Ernst Essers erfolgt, ließ sich bislang nicht erhärten. Ähnliche
stilistische Bezüge sind auf Viersener Stadtgebiet auch am Wohnhaus
Heinz-Luhnen-Straße 15 in Dülken verwendet.
Von der Ausstattung besonders hervorzuheben
sind die Buntglasfenster, nicht nur wegen ihrer Zahl, sondern auch wegen
ihrer spezifischen Ikonografie, die auch überörtlich von Interesse
ist. Schließlich manifestiert sich hier auch ein wichtiges Stück
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Mönchengladbachs, wenn auch wohl eher
zufällig auf Viersener Stadtgebiet.
Als außergewöhnlich gut erhaltenes und reich ausgestattetes
Unternehmerwohnhaus aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ist die Villa
Gladbacher Straße 779 einschließlich ihrer Einfriedigung bedeutend für
Viersen und Mönchengladbach. Ihre Erhaltung und Nutzung liegt aus den
dargelegten wissenschaftlichen, architektur- und ortsgeschichtlichen Gründen
im öffentlichen Interesse. Es handelt sich daher gemäß § 2
Denkmalschutzgesetz NRW um ein Baudenkmal.